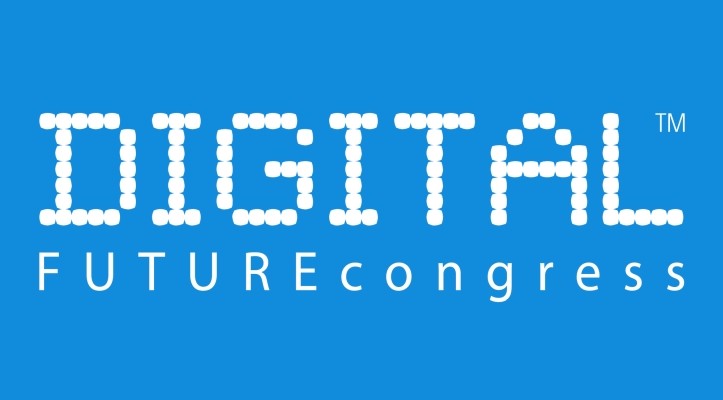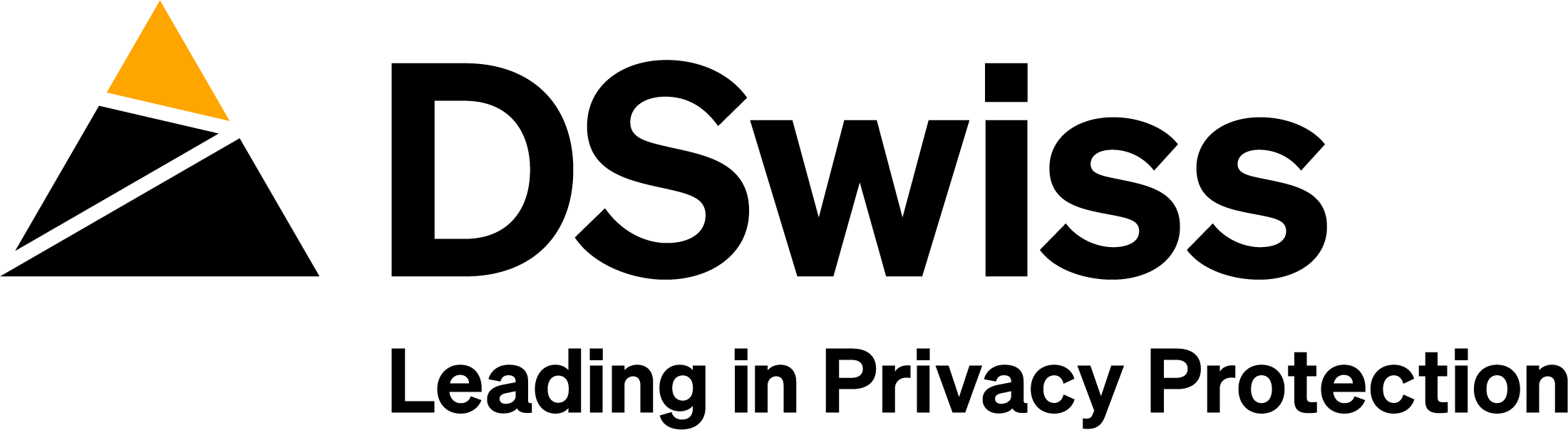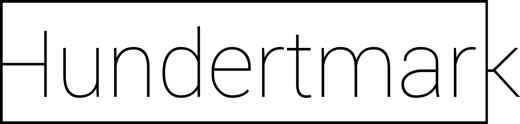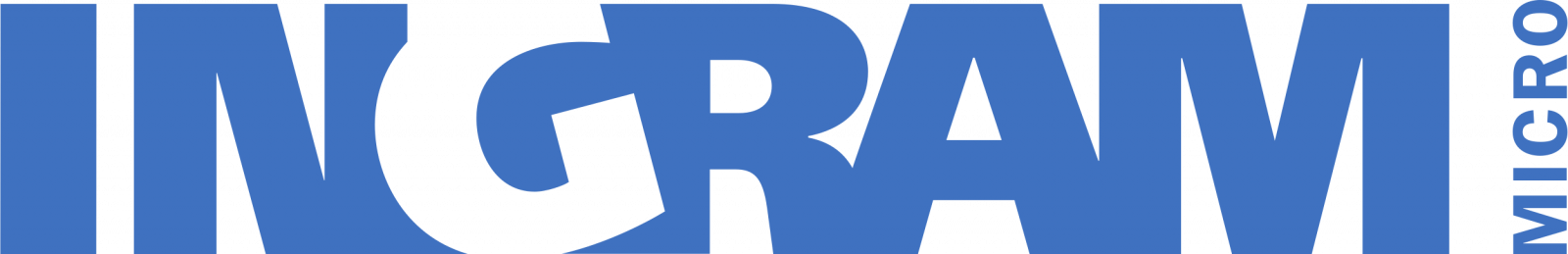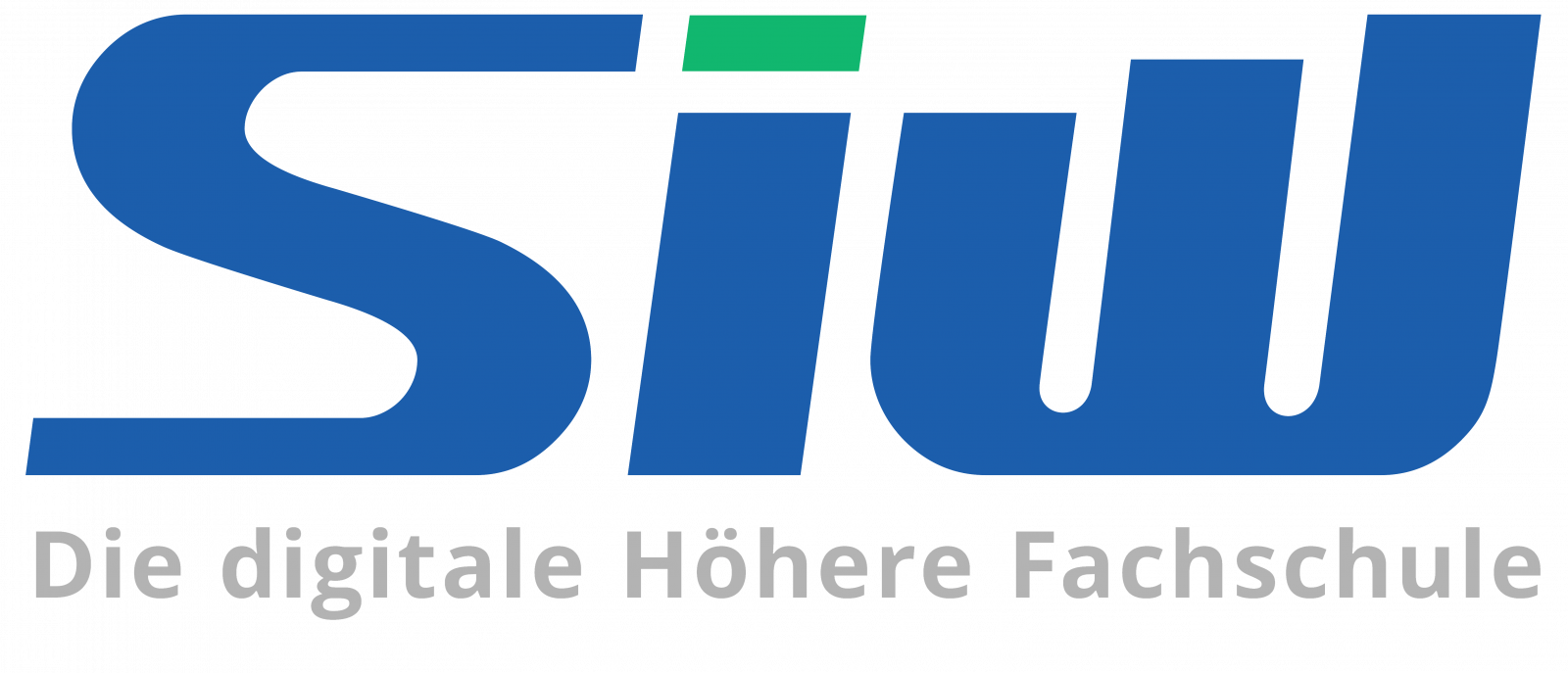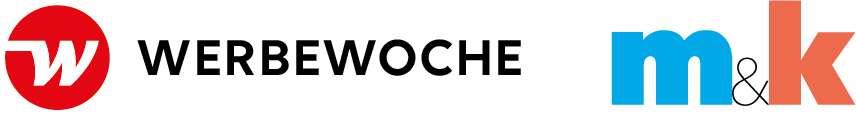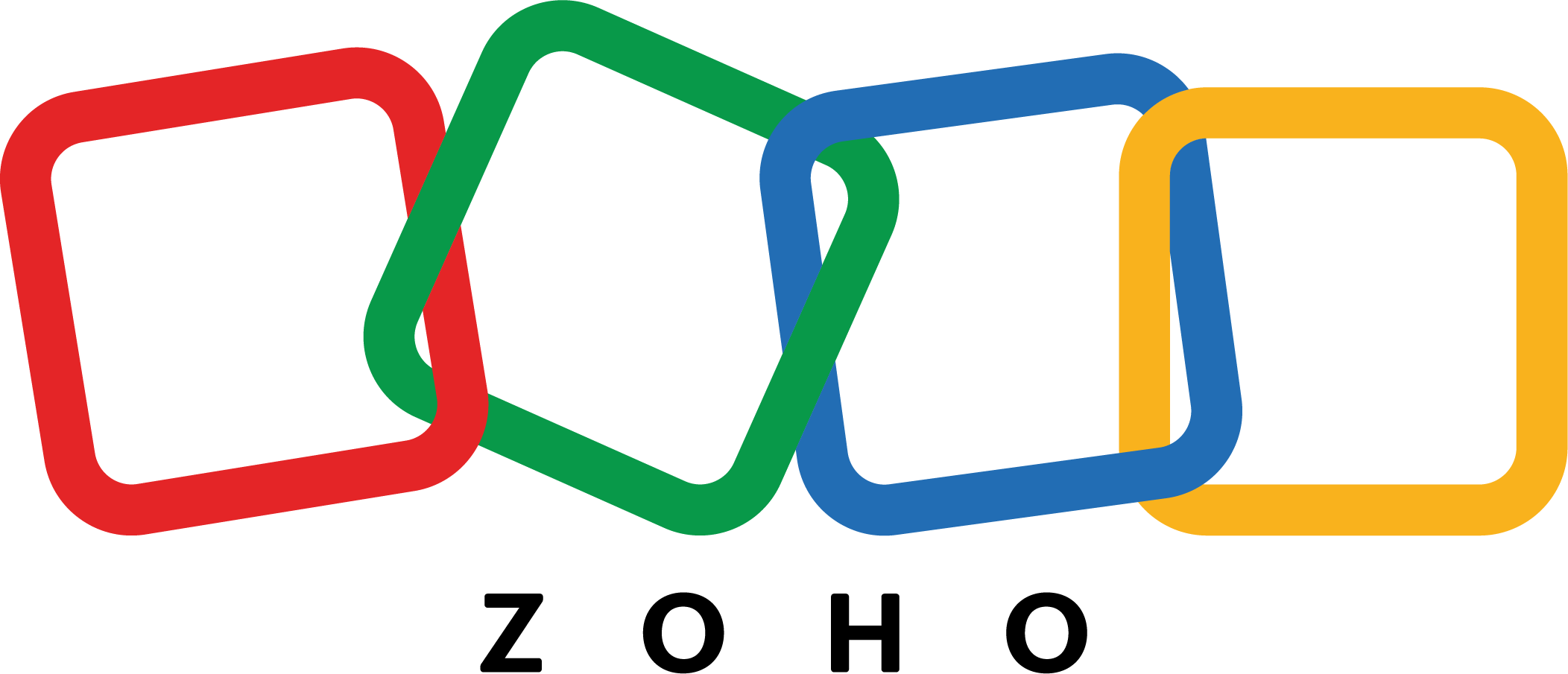«Wir müssen die Digitalisierung als gesellschaftspolitisches Anliegen verstehen»
Edith Graf-LitscherQuelle: Zeitschrift Frauenfragen
Vor gut zehn Jahren wurde auf eidgenössischer Ebene die «Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit» (Parldigi) gegründet. Sie beobachtet und begleitet digitale Entwicklungen und berät Interessierte auf Bundesebene. Wir haben mit der Co-Präsidentin Edith Graf-Litscher über die Herausforderungen der Digitalisierung gesprochen.
Frau Graf-Litscher, Sie sind Co-Präsidentin der «Parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit» (Parldigi). Wie ist die Gruppe entstanden?
Als ich 2005 in den Nationalrat gewählt wurde, hat sich noch kaum jemand mit der Digitalisierung beschäftigt. Hanna Muralt Müller, die damalige stellvertretende Bundeskanzlerin, motivierte mich, diese Lücke zu füllen. Gemeinsam mit Matthias Stürmer als Geschäftsführer (heute Institutsleiter für digitale Nachhaltigkeit an Universität Bern) und meinem Ratskollegen Christian Wasserfallen (FDP) gründete ich die überparteiliche «Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit». Das Kernteam setzt sich heute aus einem Mitglied jeder Fraktion zusammen. Über das direkte Gespräch mit Entscheidungsträger*innen in der Bundesverwaltung haben wir einiges erreicht. Heute sind wir die Anlaufstelle für Bundesverwaltung und Bundesrat, wenn es darum geht, Positionierungen des Parlaments zu digitalen Fragen abzuholen. Zu Beginn der Digitalisierung haben sich fast ausschliesslich Unternehmer*innen geäussert und meist vom technischen Nutzen gesprochen. Diese Diskussion versteht kaum jemand. Um die Entwicklung zu begleiten und zu steuern, müssen digitale Fragen gesellschaftspolitisch diskutiert werden, sowohl partei- als auch geschlechtsübergreifend. Wir müssen den Nutzen für die Bevölkerung aufzeigen.
Weshalb trägt die Gruppe den Titel «Digitale Nachhaltigkeit»?
Anfangs ging es hauptsächlich um nachhaltige Beschaffungen. Wir haben die freihändischen Beschaffungen des Bundes kritisiert, wenn es hiess: «Das kann eben nur Microsoft.» Wir setzen uns dafür ein, dass digitale Produkte öffentlich zugänglich sind. Ein aktuelles Beispiel für digitale Nachhaltigkeit ist die Covid-App. Wir haben den Prozess eng begleitet, um sicherzustellen, dass Open Access, Open Data und Open Source1 gewährleistet sind, dass also beispielsweise der Quellcode offen liegt und der Datenschutz gewährleistet ist.
Im neuen Legislaturprogramm 2019–2023 des Bundesrates soll die Digitalisierung mehr Gewicht erhalten. Die Leitlinie 1 lautet: «Die Schweiz sichert den Wohlstand und nutzt die Chancen der Digitalisierung». Sind Sie zufrieden damit?
Meines Erachtens ist es wichtig, dass die Leitlinie vorgegeben ist. Aber ein Legislaturprogramm hat immer eine gewisse Flughöhe. Für uns ist letztlich die praktische Umsetzung zentral. Es braucht jemanden, der die Leitlinie in engem Austausch mit Bundesverwaltung und Bundesrat konkretisiert und kontrolliert. Genau das ist unsere Aufgabe.
Beim Studium diverser Berichte des Bundesrates, des Staatssekretariat für Wirtschaft SECO oder des Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI2 fällt auf, dass Geschlecht kaum Thema der Digitalisierungsdebatte auf eidgenössischer Ebene ist. Ist die Schweiz bezüglich der Digitalisierung geschlechterblind?
Ich glaube, es läuft bei der Digitalisierung nicht anders als sonstwo. Aus Gleichstellungsperspektive muss man die Lücken und Herausforderungen aufzeigen. Besonders im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Automatisierung stehen wir heute an einem Wendepunkt. Frauen müssen sich verstärkt eingeben. Denn Technologie ist nicht neutral, Frauen dürfen nicht fehlen und ich appelliere deshalb auch an sie. Die IT ist ein sehr spannendes Berufsfeld. Wenn Frauen nicht Teil davon sind, dann kommt es zu Diskriminierungen. Dasselbe gilt auch für andere Kategorien wie «race» und Religion. Wir brauchen die Diversität in der Entwicklung der Technologie. Es darf uns nicht egal sein, was hier passiert. Wir müssen die Digitalisierung als gesellschaftspolitisches Anliegen anstatt als rein technisches Thema verstehen.
Studien zeigen heute: Diejenigen Menschen, welche die Digitalisierung gestalten, sind vor allem männlich, weiss und gut bezahlt. Die entstehenden technischen Produkte lassen daher die Perspektive von Frauen, nicht-weissen und geringverdienenden Menschen ausser Acht oder sind sogar diskriminierend. Was tut die Politik, um dies zu ändern?
Man versucht schon lange, Frauen für technische Berufe zu gewinnen. Um das zu erreichen, muss jedoch aufgezeigt werden, was aktuell geschieht. Das Desinteresse der Frauen bezüglich der Digitalisierung kann die Entwicklung nicht stoppen. Es wird nicht einfach alles gut. Denn die Prozesse laufen bereits. Es gibt keine Entwicklung ohne oder jenseits der Digitalisierung. Es gilt deshalb, digitale Entwicklungen zu verstehen und kritische Fragen zu stellen, speziell auch hinsichtlich digitaler Ethik. Es braucht ein anderes Anforderungsprofil, um Frauen für technische Berufe zu gewinnen, nicht einfach den Computerfreak, sondern Menschen, die ethische Fragen einbringen, die Algorithmen gestalten und Diskriminierungen feststellen. Ich bin auch keine Computer-Fachfrau, aber ich kann die richtigen Fragen stellen.
Lebenslanges Lernen wird im Kontext der Digitalisierung immer wichtiger. Ein Blick in die Statistik zeigt derweil: Von Weiterbildungen profitieren heute vorab gut gebildete, Vollzeit arbeitende Erwerbstätige. Geringverdienende, Teilzeit arbeitende Frauen bleiben aussen vor. Akzentuiert die Digitalisierung diese Zweiklassengesellschaft?
Meines Erachtens sind wir auch bei der Weiterbildung an einem Wendepunkt angelangt. Heute liegt die Verantwortung für Weiterbildung in den Händen der Arbeitnehmenden. Aber eine alleinerziehende Mutter, die Teilzeit erwerbstätig ist, kann nicht auch noch zweimal die Woche einen Abendkurs absolvieren. Wir erkennen heute die Chancen der Digitalisierung. Insgesamt können wir mit der Technik einen Produktivitäts- und Zeitgewinn erwirtschaften. Dieser muss aber an die Gesellschaft zurückfliessen, beispielsweise in Form von Weiterbildungen während der Arbeitszeit und unter Mitfinanzierung durch die Arbeitgebenden und die öffentliche Hand. Ein gutes Instrument sind zudem Standortbestimmungen. Schon heute gibt es Kantone und Unternehmen, die ihren Arbeitnehmenden ab 40 Jahren regelmässige Standortbestimmungen anbieten. Denn einfach wild drauflos irgendeine Weiterbildung zu absolvieren, bringt nichts. Weiterbildungen müssen zielgerichtet sein. Insbesondere, wenn sich ein Berufsfeld sehr rasch ändert. Das habe ich selbst erlebt. Ich bin ursprünglich Bahnhofsvorständin. Meine Lehre habe ich in einem damals noch mechanischen Stellwerk absolviert. Die technologische Entwicklung in meinem Beruf war rasant: von der Bedienung von Hand, über die mechanische und die elektrische hin zur elektronischen Steuerung. Meiner Meinung nach müssten heute über 40-Jährige alle fünf Jahre das Recht auf eine Standortbestimmung haben. Das könnte man über Weiterbildungs-Gutscheine organisieren.
Braucht es ein Weiterbildungs-Obligatorium?
Ich denke, es ist eher kontraproduktiv, wenn man Menschen zu Weiterbildungen zwingt. Aber man kann mit einer Finanzierung durch die öffentliche Hand und sozialpartnerschaftlichen Lösungen sicherstellen, dass Weiterbildungen für alle machbar werden.
Sie sagen, die Produktivitätsgewinne der Digitalisierung müssen in die Gesellschaft zurückfliessen. Derzeit erzielen jedoch vorab grosse Konzerne dank der Digitalisierung immense Gewinne, ohne diese zu versteuern.
Sie haben recht, die Besteuerung der Grosskonzerne ist zentral. Häufig haben diese ihren Sitz jedoch nicht in der Schweiz. Die internationale Zusammenarbeit, unter anderen mit der EU, ist deshalb auch wichtig. Vermehrt stellen wir heute aber auch fest, dass die Einnahmen von unterschiedlichen IT-Unternehmen kommen, nicht mehr ausschliesslich von den grossen Playern.
Der Bundesrat betont in seinen Berichten das Potenzial des Home-Office im Kontext der Digitalisierung. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf werde einfacher. Kritikerinnen warnen aber auch vor einer Entgrenzung der Erwerbsarbeit respektive davor, dass sich die Flexibilisierung nicht zum Nutzen der Arbeitnehmenden, sondern zum Anspruch an sie wandelt. Wie schätzen Sie das ein?
Ich spreche am liebsten vom mobilen Arbeiten; sei es im Zug, zu Hause oder in einem Co-Working-Space. Hier gilt es Regelungen zu treffen, auch hinsichtlich des Arbeitnehmendenschutzes. Die Corona-Krise hat Stärken und Schwächen des mobilen Arbeitens aufgezeigt. Viele waren im Home-Office zufrieden. Oft entsprach die Arbeitsbelastung jedoch nicht ganz dem courant normal, viele hatten weniger zu tun als vorher. Es wurden aber auch Risiken sichtbar. So waren es überwiegend Frauen, die neben dem Home-Office auch das Home- Schooling und die Kinderbetreuung sichergestellt haben. Ihre Belastung war immens. Wir müssen die Diskussion über das mobile Arbeiten auf gesellschafts- und gleichstellungspolitischer Ebene führen. Es gibt zudem sozialpartnerschaftliche Fragen, welche branchenspezifisch beantwortet werden müssen, genauso wie Arbeitszeit- und Lohnfragen. Mobiles Arbeiten schenkt einerseits Freiheiten, verlangt aber andererseits auch klare Zuständigkeiten und Abgrenzungen. Es ist wichtig, hier Lösungen zu finden, die uns volkswirtschaftlich weiterbringen.
Sehen Sie die Digitalisierung eher als Chance oder als Risiko für die Gesellschaft? Die Digitalisierung ist ganz klar eine Chance. Vor allem, weil wir sie entgegen der landläufigen Meinung mitgestalten und steuern können. Dafür aber müssen wir sie verstehen und uns überlegen, was wir wollen, in welche Richtung es gehen soll. Es braucht immer den Menschen und die Maschine, aber die Rollen müssen geklärt und gestaltet werden. Die Digitalisierung muss in erster Linie den Menschen nützen und nicht dem Profit. Was wünschen Sie sich vom Bundesrat? Ich wünsche mir, dass der Bundesrat seine Entscheide zum Wohle der Bevölkerung fällt. Die Lösungen müssen den Menschen nützen, den Standort Schweiz stärken und in Bezug auf Diversity breit abgestützt sein, damit es nicht zu Diskriminierungen kommt. Wo müsste die EKF aktiv werden? Die EKF kann die aktuelle Entwicklung aufzeigen und die Bevölkerung dafür sensibilisieren. Die Digitalisierung ist nicht wie das Wetter, bei dem wir akzeptieren müssen, dass es regnet oder die Sonne scheint. Die EKF kann aufzeigen, dass die Digitalisierung gestaltet werden kann. Gerade in Bezug auf ethische Aspekte kann die EKF einen glaubwürdigen Beitrag leisten.